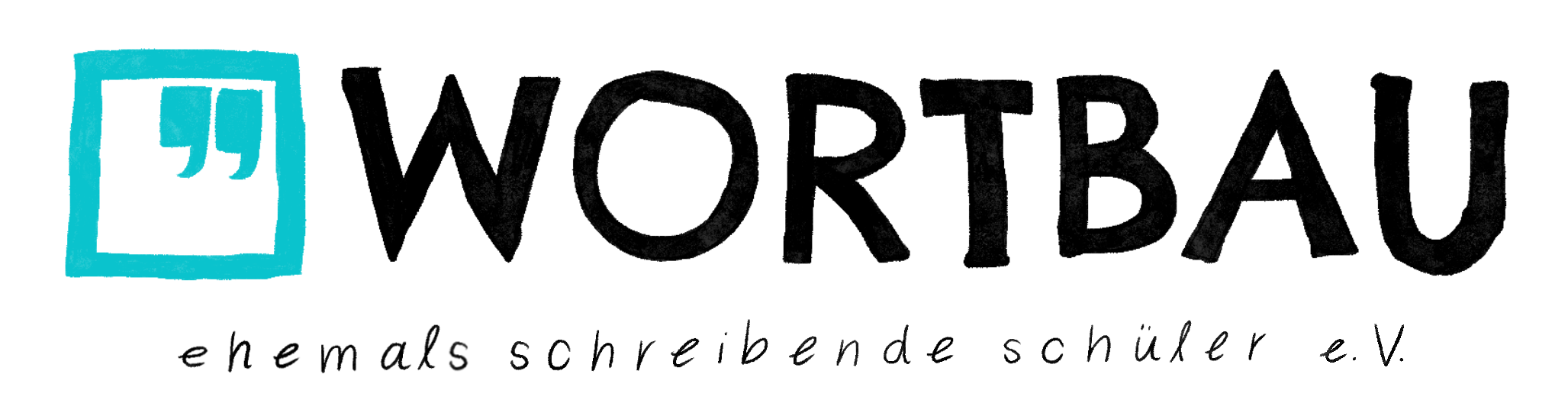Texte 2017
Die geheimnisvolle Lampenfabrik
Hannes Martin Hartmann (7 Jahre), Magdeburg – Junior-THEO
In einem tiefen Wald stand eine Lampenfabrik. Sie war aus Holz und nur klein, denn es gab nicht genug Eisenerz, um sie größer zu bauen. Alle Arbeiter sind mit der Zeit gegangen, denn weil die Baupläne immer komplizierter wurden, wollte niemand mehr in der Lampenfabrik arbeiten. So sind alle Menschen nach und nach weggezogen. Einige sind auch gestorben.
Bevor die Arbeiter die Fabrik verlassen hatten, sortierten sie die Lampen ordentlich in die Regale. Doch das war nicht das Einzige, was an dieser verlassenen Lampenfabrik besonders war. Die Lampen lebten nämlich und konnten sich mithilfe von Lichtzeichen miteinander unterhalten.
Meist waren die Lampen freundlich zueinander. Manchmal bauten sie sich gegenseitig um, damit sie keinen Strom mehr verbrauchten, sondern durch Kurbeln betrieben werden konnten, denn langsam ging ihnen die Energie aus. Hin und wieder zankten die Lampen auch. Vor allem darüber, wer die Größte war oder welche den Menschen am besten gefallen würde.
Menschen hatten sie allerdings schon lange nicht mehr gesehen. Sie waren sich jedoch sicher, dass die Menschen sich über die hübschen Lampen freuen würden, wenn sie nur einen Blick in die Fabrik werfen könnten. Doch zwei ausgesandte Lampen, die ausspionieren sollten, wie die Menschen jetzt für Licht sorgten, hatten herausgefunden, dass schon lange keine Holzfäller mehr im Wald gewesen waren und dieser nun dicht bewachsen war. Und so lebten die Lampen weiterhin verborgen und keine Menschenseele wusste, dass sie überhaupt noch existierten.
Mit der Zeit trauten sich die Lampen auch in die oberen Etagen der Fabrik, um nach anderen Lampen zu suchen, aber sie fanden nur halbfertige Exemplare. Zudem waren die Baupläne halb zerrissen, sodass sie sie nicht genau lesen konnten. Sie dachten schon, dass sie vielleicht einen Blick in den geheimnisvollen Raum im siebten Stock riskieren könnten, aber es gab nicht genügend funktionierende Lampen, um für ausreichend Licht zu sorgen.
Als noch Menschen in der Fabrik gearbeitet hatten, hatten diese große Angst vor den Tieren im Wald gehabt. Tagsüber hatten sie die Tür verbarrikadiert, damit keine tollwütigen Tiere hereinkommen konnten. Als der letzte Mensch die Fabrik verlassen hatte, war die Tür von außen abgeschlossen worden und die Lampen somit in der Fabrik gefangen. Leider gab es in der Fabrik auch keine Fenster, sodass nur eingeschaltete Lampen für Licht sorgen konnten. Im Dunkeln war es jedoch sehr schwer, die Lichtschalter zu ertasten oder sich gegenseitig aufzuziehen. Daher fassten die Lampen den Plan, mithilfe der übrig geblieben Bauteile einen Bohrer zu bauen, um Löcher in die Fabrikwände bohren zu können. Einige der Lampen hatten Angst, dass die Fabrik dann zusammenstürzen könnte, daher beschlossen sie, es lieber doch nicht zu tun. Auch wäre es ziemlich anstrengend, die Löcher zu bohren.
Stattdessen suchten sie alle Räume nach Ritzen ab. Wenn sie einige der wenigen Ritzen fanden, waren diese nur dünn und ließen kaum Licht in die Fabrik. Die Lampen befürchteten jedoch, dass es sehr kalt werden könnte, wenn sie die Tür öffneten. Dann müssten sie sich nachts aneinander kuscheln, denn sie hatten nur wenige dünne Sachen zum Wärmen gefunden. So beschlossen sie, lieber nur durch die Ritzen der Holztür zu schauen.
Einige der Lampen hatten schon angefangen, teilweise den Boden der Fabrik auszuheben, für den Fall, dass der Strom ausfiel oder die Kurbeln kaputtgingen. So hätten sie wenigstens ein Grab. Man muss wissen, dass die Lampen sehr empfindlich waren, denn sie hatten große Angst, kaputt zu gehen.
Eines Tages schafften sie es jedoch, eine Ritze in der Tür zu brennen, denn manche Lampen wurden sehr heiß. So schafften sie es, endlich in die Freiheit zu gelangen.
Als sie sahen, dass Menschen kamen, wurden sie ängstlich und versteckten sich. Bald erkannten sie jedoch, dass es Holzfäller waren, die die Fabrik entdeckt hatten. Als sie bemerkten, dass die Menschen die Fabrik nicht zerstörten, trauten sie sich nach und nach hervor.
Die Menschen, die in einem Dorf am Rande des Waldes lebten, waren froh, eine Fabrik mit lebenden Lampen zu finden, denn ihnen gefiel das Spektakel. Sie bauten eine Bühne, auf der die Lampen Schattenspiele vorführten. Zudem hatten die Menschen nicht mehr viel Geld und so beschlossen sie, den Lampen ein Museum zu bauen, bei dem die Besucher Eintritt zahlen mussten.
Die Lampen kamen in das Museum, wo sie jede Nacht fröhlich herum hüpften und spielen durften. Jeden Tag wurden sie mit genügend Strom versorgt, sodass sie lange leben konnten und nicht mehr im Nichts des dichten Waldes um Energie bangen mussten. Und wenn sie nicht verschrottet wurden, dann leuchten sie noch heute.
Liah
Anna-Ilayda Kluth (12 Jahre), Bad Schwartau – Prosa 10-12
Zum ersten Mal heute schloss ich die Tür auf. Der Geruch nach Waschmittel und dem Eintopf, den Waltraud donnerstags kochte, verschwand und wich beißendem Reinigungsmittel. Ich schwankte und griff nach dem Treppengeländer. Einen Moment lang blieb ich so stehen und versuchte das Gleichgewicht wiederzufinden. Dann fing ich an zu laufen. Schritt für Schritt. Konnten die Nachbarn hören, wer da die Treppe runter lief? Ich jedenfalls erkannte die Schritte der anderen jedes Mal. Das Haus, in dem ich wohnte, war eines der neueren in Berlin, aber es wohnten fast nur alte Menschen darin. Liah war das einzige Kind im Haus und manchmal tat sie mir leid. Allein mit ihrem Vater, dem schlurfenden Dackel und 12 alten Knackern, die sich ständig über sie beschwerten. Oder bei mir, weil ich mich nicht bei ihr beschwerte. Doch das hatten sie schon lange nicht mehr getan. Sie beschwerten sich zwar immer noch, aber nicht mehr bei mir. Sie waren alle ja froh, dass Liah im Haus wohnte. Es war ein sonniger, aber kalter Dezembermorgen. Ich ging den Weg am Kanal entlang. Der wenige Schnee, der noch nicht der Sonne nachgegeben hatte, knirschte unter meinen Füßen. Mir begegneten kaum Menschen. Ich hatte schon lange damit gerechnet. Am Montag hatte sich Waltraut bei mir gemeldet und teilte mir mit, dass sie nicht kommen könne. Einkäufe seien in der Abseite, ich bräuchte nur den Mikrowellen-Fisch aufzuwärmen, spätestens in einer Woche sei sie wieder da. Ich wünschte ihr gute Besserung und legte auf. Von den Vorräten war nur noch wenig übrig, und so ging ich einmal großeinkaufen, um die nächsten Tage das Haus nicht mehr zu verlassen müssen. Ich wurde mit dem Wissen geboren, dass Menschen sich auflösen konnten. Wenn Menschen vergessen werden, dann löst sich ein großer Teil von ihnen auf, und übrig bleibt ein Leben in eine Art Dämmerzustand zwischen Wachsein und Traum. So etwas passierte mit mir. Ich wurde immer unauffälliger und blasser, und jetzt schlug das Nichts endgültig zu und versuchte mich zu einem Teil von ihm zu machen. Zu einem meiner Anhaltspunkte, dass die Außenwelt trotz meines Verschwindens trotzdem noch existierte, gehörte Liah. Morgens hörte man, wie eine Art Rollkoffer die Treppe runtergezogen wurde, Stufe für Stufe, das ganze Treppenhaus. Radrumm, radrumm, radrumm. Wenn sie im Hof angekommen war, verwandelte sie ihren Koffer in einen Schulranzen. Sie schloss ihr Fahrrad umständlich auf und meistens fiel es dann auch scheppernd um. Im Hof stand eine alte Kastanie. Im Herbst schoss sie mit einer Steinschleuder die Kastanien von den Ästen. Manchmal verfehlte sie sie und traf die Hauswand dahinter. All diese Geräusche hatte ich vorher nie wahrgenommen. Ich fing allgemein mehr an, auf Sachen zu achten, die mir früher vollkommen egal waren. Wie zum Beispiel, als Liah wieder mal außer sich vor Wut von der Schule kam. Sie ließ ihr Fahrrad auf den Weg, der zur Tür führte, fallen. „Das ist für Englisch!“, hörte ich sie schreien. Tock. Das Geräusch einer Kastanie, die auf dem Boden aufkam. „Und das ist für Deutsch!“ Tock. „Und das ist für dieses verfluchte Geschichte.“ Tock. „Wer braucht schon Geschichte?!“ Sie hörte auf, Kastanien vom Baum zu schießen. „Und keinen interessiert Geschichte!“ Jetzt schrie Liah nicht mehr. Sie war mitten im steinigen Hof zusammengebrochen und hatte das Gesicht in die Hände gelegt. Erst später begriff ich, dass sie weinte. Am nächsten Morgen hörte ich wie jemand in aller Frühe durch das Treppenhaus lief, klopfte, einen kurzen Wortwechsel mit dem Öffner der Tür führte und dann weiterzog. Erst, als die Person im viertem Geschoss klopfte, erkannte ich die Stimme von Frau Gred. Auch was sie sagte, war nun verständlich. Als im viertem Geschoss die Tür geöffnet wurde, begann sie sofort; „ Guten Morgen Herr Wälser, verzeihen sie, dass ich so früh störe. Ich habe aber vor, noch bevor er zur Arbeit fährt, Richard Domemeyer über das zweifelhafte Verhalten seiner aggressiven Tochter Liah zu informieren und ihn aufzufordern, seine Tochter besser zu erziehen. Ich sammle Unterschriften von Mitbewohnern, die genauso denken“.
„Wo muss ich unterschreiben?“, brummte Herr Wälser undeutlich.
„Hier“, antwortete Frau Gred zufrieden.
Als nächstes hörte ich, wie sie sich verabschiedeten und eine Tür zuschlug. Dann ging sie die letzte Treppe ins fünfte Geschoss rauf. Ich erwartete, dass sie als nächstes bei mir klingeln würde. Stattdessen klopfte sie gegenüber bei den Domemeyeres. Ich stieg aus dem Bett und ging zu dem Guckloch in der Tür. Frau Gred wartete ungeduldig, bis ein müder, unrasierter Herr Domemeyer die Tür öffnete. Er trug einen khakifarbenen Bademantel über einem zerknitterten, blau-weiß gestreiften Schlafanzug. „Verdammt, es ist sechs Uhr früh, was wollen sie?“, knurrte er. Frau Gred ließ sich nicht beeindrucken. In einem einzigem Atemzug sagte sie: „Ich bin hier bezüglich ihrer Tochter Liah. Alle gefragten Nachbarn stört ihr Verhalten enorm. Wir verlangen, dass sie ihre Tochter in den Griff bekommen“ Herr Domemeyer sah sie entnervt an. „Verdammt…“, sagte er dann nochmal. „Warum in aller Welt tauchen sie so früh auf? Ich hab Besseres zu tun, als ihnen hier Rede und Antwort zu stehen. Kommen sie heute Abend wieder. Aber um Himmelswillen, lassen sie mich noch eine Stunde schlafen!“, donnerte Herr Domemeyer. Dann schlug er ihr ohne ein weiteres Wort die Tür vor der Nase zu. Im Grunde dachte Frau Gred nicht ganz anders als ich. Sie ging nicht mehr arbeiten, sie lebte allein. Das einzige Aufregende in ihrem Leben waren die Nachbarn. Bloß mir genügte es, Zuschauer zu sein. Frau Gred brauchte unbedingt eine Rolle in diesem Stück. Und ihr war klar, dass sie für Außenstehende offensichtlich den Schurken spielte. Neujahr war vorbei und wie um alle noch mehr zu provozieren, planten Liah und ihr Vater schon ihren nächsten Geburtstag. Liah wurde zehn und verteilte seit kurzem Entschuldigungszettel, die sie selbst malte. Gerade stand Liah vor Herrn Wälsers Tür und wartete anscheinend darauf, seine Reaktion zu hören. „Na, meinetwegen“, murmelte er. Eine Tür fiel ins Schloss. Als nächstes war ich dran. Als sie klingelte öffnete ich sofort die Tür. Liah war sehr klein. Sie sah eher aus wie sechs. Ihr braunes, zerzaustes Haar hatte sie hinter beide Ohren gestrichen. Trotz des Winters trug sie unter der kurzen Latzhose nur ein orangefarbenes, kurzärmliges T-Shirt. Sie reichte mir den Zettel. Dort war mit bunten Filzstiften geschrieben: Ich bitte um viel Verzeihung. Villeicht wird es bisschen laut. Danke für ihr Verzeihung. Liah.
„Könnten sie vielleicht Schlurfel, den Hund nehmen? Nur für den Geburtstag!“ Schlurfel und ich haben uns gut verstanden. Er macht am liebsten gar nichts. Und ich schaute ihm dabei am liebsten nur zu.
Gransee
Theresa Bolte (15 Jahre), Bad Freienwalde – Prosa (13-15)
Nichts ist, wenn die Kaugummis alle sind, sich die Eltern mal wieder anschweigen oder man im Mathetest einfach keine einzige Lösung herausbekommt. Das Nichts ist verdammt ärgerlich. Auch Opa mag es nicht sonderlich.
Früher hatte Opa immer Tintenflecken an den Händen und in seiner Jackentasche ein Notizbuch. Opa ist nämlich Geschichtenerfinder. Irgendwann hat er aufgehört, die Geschichten dem Papier zu erzählen, aber ich durfte sie alle hören. Jetzt redet er nicht mehr viel und wir spielen immer Modelleisenbahn miteinander. Eigentlich könnte Opa auch Schaffner gewesen sein, aber die Züge sind bei ihm wie Personen. Ich glaube, er spielt sie für mich so. Ich höre gerne zu. Nächste Haltestelle Gransee. Das ist der Ort, in dem Oma als junges Mädchen gewohnt hat.
Manchmal spricht Opa mit sich selbst. Und manchmal mit seinem Rollator. Die Geschichten, die dann aus ihm heraussprudeln sind voller komplizierter Wörter. Papa sagt, Opa Klaus spricht dann mit Oma. Deswegen glaube ich, dass Oma unsichtbar ist. Nicht einfach nicht mehr da. Aber wenn ich das Mama erzähle, findet sie mich komisch, genauso wie sie den Opa findet, also lasse ich es.
In den Sommerferien war ich das erste Mal ganz alleine bei Opa. Eine Woche lang. Also fast, nur bis Samstag. Wie Abenteuerurlaub. Wir haben ein Piratenschiff gebaut und zum Frühstück Pfannkuchen mit Schokocreme gegessen. Und anstelle des Mittagsschlafes war es Zeit für eine Partie Mensch-ärgere-dich-nicht, denn Opa sagt, manche Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Mittagsschlaf braucht wirklich keiner.
Am Mittwoch waren wir im Dorfladen und ich habe die Einkaufstüten geschleppt, weil Opa doch weite Strecken nicht mehr so gut laufen kann. Mit dem roten Rollator und Oma Gertrud ging es aber ganz gut, deswegen habe ich mich sofort sehr selbstständig und erwachsen gefühlt. Opa Klaus findet, dass Erwachsene viel zu eintönig und grau sind. Mein Schon-so-groß-Gefühl ist gleich verschwunden.
Ich hoffe, ich werde nie langweilig. Eigentlich will ich so wie Opa werden, aber Papa findet das bestimmt keine gute Idee. Fantasieren hat etwas mit Fieber und Hustensaft zu tun, sagt er oft. Ich habe ihm versprochen, nicht mehr zu fantasieren, sondern nur noch zu kreativieren. Er hat nur geseufzt und Mama hat mich ins Bett geschickt, weil ich nämlich tatsächlich gerade die Grippe hatte.
Mit dem Kreativieren habe ich bei Opa angefangen, noch vor dem Frühstück am Freitag der Ferienwoche und genauer gesagt bei seinem Rollator. Den fanden wir beide genauso eintönig und grau wie die Erwachsenen und haben ihn mit meiner Lieblingsfarbe angemalt. Rot. Bei Mensch-ärgere-dich-nicht bin ich auch immer rot. Rot verliert fast nie.
Die Griffe hat Opa umstrickt, damit sie im Winter nicht so kalt werden. Man muss vorbereitet sein, hat er gesagt und dann erzählt, dass er das Stricken bei Einheimischen am Nordpol gelernt habe, deswegen auch das schöne Zopfmuster. Dann gab es Pfannkuchen zur Abwechslung mal mit Apfelmus und jede Menge Rechnungen an Herrn Klaus in wichtig aussehenden Briefumschlägen, die ihn nicht sehr glücklich machten.
Ich könnte auch ein bisschen Rechnen üben, schlug er vor, ausgerechnet in den Ferien. Zum Glück hatte ich Opa schnell dazu gebracht, dass Sudokus fast wie Mathe und eigentlich nichts Anderes als Kreuzworträtsel sind, also haben wir Kreuzworträtsel gelöst.
Opa sagt, dass meine Worte sehr überzeugend sind und ich Politiker werden sollte. Ich glaube aber, dass die Parteien niemanden nehmen, der mit Gummibärchen zu bestechen ist. Da hat er gelacht.
Abends hat Mama angerufen. Ob ich denn schön Zähne putzen würde, dass mit den vielen Pfannkuchen fand sie nämlich nicht so lustig. Und Stricken hat Opa im Winter vor zwei Jahren gelernt, als seine Heizung ausgefallen ist. Eigentlich müsse man die ganze Anlage austauschen, meinte sie noch, aber Opa hatte einfach kurzerhand jeden einzelnen Heizkörper umstrickt und sich geweigert. Das war zu Zeiten, als sich Opa noch mehr geweigert und Mama mehr nachgegeben hat. Spricht Klaus denn viel mit Oma Gertrud? Naja, es geht, habe ich gesagt, weil Mamas immer sofort herausfinden, wenn man lügt. Dafür habe ich noch hinzugefügt, dass wir ganz toll Piraten spielen und ich statt Mittagsschlaf immer bei Mensch-ärgere-dich-nicht gewinne. Das hat es nicht besser gemacht.
Mama hat noch lange mit Opa telefoniert und so Sachen gesagt wie „er solle mit seinen Hirngespinsten aufhören“ und „den Jungen nicht anlügen“, dabei war das mit dem Stricken nicht mal ganz gelogen, das Zopfmuster war tatsächlich total schön. Opa hat gesagt, sie würde ihrem Sohn die Kreativität rauben. Damit war wohl ich gemeint. Als es mir zu laut wurde, bin ich schon mal Zähne putzen gegangen und habe meinen Schlafanzug angezogen.
Als ich dann im Bett lag und Opa Klaus nicht kam, fragte ich mich, ob ich auch ohne Gutenachtgeschichte einschlafen könnte. Gerade als ich zu einem Nein gekommen war, öffnete er die Tür. In der Hand hatte er den Mensch-ärger-dich-nicht-Würfel, den ich daran erkannte, dass er der einzige pinke Würfel war, den ich je gesehen hatte. Opa fragte, ob ich die Wahrscheinlichkeit kenne, mit der eine bestimmte Zahl gewürfelt wird. Keine Ahnung. Eins zu sechs, sagte er, Eins zu sechs. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine vier gewürfelt wird? Eins zu sechs. Eine zwei? Eins zu sechs. Eine sechs? Eins zu sechs. Und die Wahrscheinlichkeit, dass deine Mutter freundlich zu mir ist? Da schwiegen wir beide. Das war nämlich gar nicht wahrscheinlich. Dann meinte Opa, er gewinne jetzt ein bisschen oder verliere eben, diese Wahrscheinlichkeit sei höher, als einem vernünftigen Erwachsenen zu begegnen und wieder einmal war ich froh noch klein zu sein. Und ich schlief ein.
Am nächsten Morgen war Opa schon in der Küche. Er sah traurig und müde aus. Vom Geld, um das er in so einem komischen Spielehaus gespielt hatte, war nichts mehr übrig, was mich an die leere Kaugummipackung erinnerte. Ich malte Opa ein schwarzes Loch, was mir ziemlich gut gelang und Opa malte Minusse vor die Würfelzahlen. Wären wir doch besser in Mathe gewesen, dachte ich. Und dann kamen Mama und Papa, um mich abzuholen, weil sie meinten, dass Opa nicht auf mich und sein Geld aufpassen könne. Mama glaubte, dass Opa halluzinierte und Papa, dass er manchmal wie ein schwarzes Loch im Kopf habe, in das seine Erinnerungen fallen. Mama glaubte, dass Opa zu viel sehe und Papa, dass er zu wenig wisse, was doch wieder auf nichts hinausläuft, nichts war falsch, aber das hatte niemand verstanden. Mama sagte, ich müsse sofort nach Hause und Opa Klaus in ein Heim, was ich nicht verstand, weil er doch ein Haus hatte. Dann sagte Opa, er gehe Streuselschnecken für uns alle kaufen und Mama freute sich, weil er mit uns und nicht mit Oma Gertrud redete und Papa freute sich, dass sich Opa daran erinnerte, dass sie Streuselschnecken mochten, aber in Wahrheit ging er einfach nur zum Bahnhof und setzte sich in den Zug nach Gransee.
Jetzt besuche ich Opa immer im Altenheim, in der Ecke seines Zimmers steht noch der rote Rollator, nur für die Modelleisenbahn ist kein Platz. Deswegen habe ich ihm so eine kleine batteriebetriebene Lok aus dem Spielzeugladen mitgebracht, für die man keine Schienen braucht. Es ist aber nicht das Gleiche. Wenn ich also bei ihm bin, machen wir Kreuzworträtsel oder spielen Mensch-ärgere-dich-nicht, niemals Mathe. Wenn Opa alleine ist, beschreibt er die Wände. Die Leute hier denken, er wüsste nicht, dass man Geschichten erzählt oder auf Papier schreibt.
Der kleine Baron
Cora Grohmann (17 Jahre), Dresden – Prosa (16-18)
IV
Leben, dachte der kleine Baron, und er dachte es, weil die Sekunde danach verlangt hatte.
Ein Gefühl sank in ihn, das warm und fremdartig von Zelle zu Zelle kroch und sein Innerstes nach außen stülpte.
Er kannte dieses Gefühl.
Existieren, sich verlieren im unreflektierten Moment. Lieben. Hassen. Tier-sein. Mehr-als Tier-sein. Verlangen. Verzweifeln. Fragen. Sinn suchen. Sich einbilden, Sinn zu finden. Mitspielen oder rebel- lieren, revolutionieren. Leiden. Strom-sein, fließen. Suchen und in denen, die das Gleiche suchen, das finden, was man nicht gesucht hat, aber eben doch gefunden hat. Sich mit Doppelschleife irgendwo dranknoten und dann mühevoll wieder abfriemeln. Rennen, springen, fliegen, fallen. Alt werden, also Teig sein und in der Kuchenform der Umstände gebacken werden. Orientierungslos nach seiner selbstgemalten Landkarte laufen. Weinen, bluten, hoffen, träumen. Sich kaputtmachen, weil man ganz sein will. Pulsieren, Kreislauf-sein.
Mit gebrochener Stimme rief der kleine Baron seine blaue Zofe und trug ihr auf, die blecherne Badewanne mit den salzigsten und traurigsten Tränen zu füllen, die sie im ganzen Königreich auftreiben konnte.
Die blaue Zofe seufzte, denn das konnte nur bedeuten, dass er sich wieder einmal zerdacht hatte. Das kam zwar nicht allzu oft vor, musste aber umgehend behandelt werden.
III
Die Misere des Königreichs war groß.
Der kleine Baron, der von seinen Untertanen sehr geschätzt und verehrt wurde, litt unter einer unbe- kannten Krankheit und lag seit nun etwa einem Monat wie leblos auf seinem Himmelbett. Bis auf blaue Blumen verweigerte er jegliche Nahrungsaufnahme, zum Aufstehen oder Sprechen konnte man ihn nicht animieren. Man ließ verschiedene Gaukler zu ihm heranführen, holte Ärzte und Tänzer, setzte ihm die köstlichsten Speisen vor und las ihm aus seinen liebsten Büchern vor, doch an seinem Zustand änderte sich nichts.
Als bereits Stimmen laut wurden, man müsse wohl oder übel einen Nachfolger ernennen, erschien plötzlich ein etwas verschrumpelt aussehender, schäbig gekleideter Herr am Hof. Unterm Arm trug er einen überdimensional großen Aktenkoffer.
II
Das ganze Königreich war in den Schlosspark einberufen worden und so versammelte sich nun ein schnatternder und von bunten Sonntagshüten getupfter Haufen zwischen Rosensträuchern und Kastanienbäumen. Spannung und Hoffnung hingen in der Luft, als der Professor mit bedächtigen Schritten die knarzende Holzbühne betrat, die extra für diesen Anlass errichtet worden war.
Er warf einen ernsten Blick in die Menge, schnäuzte sich und schob dann entschlossen seine goldene Professorenbrille hoch.
»Sehr geehrte Kreaturen und Nicht-Kreaturen!
Ich weiß, dass ihr diesen Tag lange erwartet habt, denn ich spüre die Liebe, die Ihr für seine Majestät, den kleinen Baron, im Herzen tragt. Lange genug habt Ihr nun um seinen Zustand gebangt, heute möchte ich euch endlich meine Vorschläge zu seiner Behandlung unterbreiten.«
Ein Raunen ging durch die Menge, vermengt mit einzelnen Jubelrufen und erleichterten Seufzern.
»Beginnen möchte ich allerdings mit meiner Diagnose, da diese von wesentlich größerer Bedeutung ist als ihre Therapie. Ich bin kein Freund von großen Worten und da diese wohl kaum zur Genesung des kleinen Barons beitragen werden, fasse ich mich also kurz: Die rätselhaft Krankheit, die seine Majestät seit nun zwei Monaten an sein Bett fesselt, ist…«
Er hielt kurz inne, schloss die Augen und kostete aus, wie eine gespenstige, durch keinen Atemzug durchbrochene Stille in der Menge lag.
»… Nichts.«
Er ertastete das Wort vorsichtig, formte es aber selbstsicher und schickte es mit Nachdruck in alle Ohren und Gehirne des Königreichs. Im Kopf zählte er die Millisekunden, bis aus der gespannten Stille wie erwartet eine Symphonie aus Empörung, Unglauben und Verwirrung wurde.
»Meine Damen und Herren, Sie alle unterliegen einem gewaltigen, jedoch naheliegenden Denkfehler: Sie assoziieren das von mir bewusst gewählte Wort »nichts« mit der Abwesenheit von Krankheit und schlussfolgern daraus, dass der kleine Baron meiner Einschätzung nach gesund ist. Dem ist nicht so. Um ihnen das verständlich zu machen, muss ich allerdings erst ausführen, worin sein jetziges Befinden einen Ursprung hatte.«
Statt in die Menge zu blicken, wandte er sich nun an die blaue Zofe am Rand der Bühne, die er sicher auf seiner Seite wusste. Stirnrunzelnd rang sie sich ein kurzes Nicken ab, schließlich wusste er doch, dass er einfach fortfahren konnte.
»Heute vor circa zwei Monaten fand im Gehirn des kleinen Barons etwas statt, dass ich zu Forschungs- zwecken als »Zerdenken« bezeichnet habe: Völlig unerwartet und ohne jeglichen Zusammenhang drängte sich ein Gedanke in seine Synapsen, der von einer solchen Wucht war, dass er für einen kurzen Zeitraum vom ganzen Wesen des kleinen Barons Besitz ergriff.
Wie im Wahn muss sein Körper nun all seine Energie darauf verwendet haben, dem Gedanken zu dienen, sein Verlangen zu stillen. Man könnte fast meinen, es habe sich um eine Frage gehandelt, von deren absoluter und richtiger Beantwortung sein Leben – wenn nicht sogar alles Leben – abhängig gewesen wäre. Aus jeder grauen Zelle kratzte er Assoziationen und verlor sich in einem Schwall aus Folgegedanken, die er aufgrund ihrer Schnelligkeit und Absurdität jedoch selbst nicht erfassen konnte.
Nach wenigen Millisekunden dieser extremen Überstimulation müssen seine Antwortmöglichkeiten ausgeschöpft gewesen sein und in ihm breitete sich eine innere Leere aus, von der ich mir nicht anmaße, sie nachvollziehen zu können.
In diesem Moment verlor sich für den kleinen Baron alles jemals Gewesene und Gedachte in Bedeutungslosigkeit; seit nun zwei Monaten vermag er nicht einmal mehr zu begreifen, was Bedeutung und Sinn überhaupt sind. Sein Organismus erhält ihn, er spürt sich aber nicht mehr. Er fühlt nichts, denkt nichts, wünscht nichts, hofft nichts, weiß nichts, braucht nichts.
Der kleine Baron IST nichts.«
Froschartig aufgerissen blickte ihm ein Meer aus Augen entgegen, wenige davon weinend, andere sichtlich abwesend und bei seinen Ausführungen bereits abgedriftet, die der Kinder gelangweilt und träumend vom nachmittäglichen Spiel.
I
Die Worte flossen zwar raus, er scharrte dabei aber halbherzig mit seinen klobigen Schuhen auf den Holzdielen herum und blickte erst nach Beendigung seiner Ausführungen wieder selbstzufrieden lächelnd in die Menge.
Er hatte nie verstanden, was diese Kreaturen so am Normalzustand reizte, wenn doch die Abweichung davon so viel mehr Brisanz und Relevanz bereithielt.
Du bist eben ein Poet, hätte seine Frau jetzt gesagt.
leben, still
Anile Tmava (18 Jahre), Berlin – Lyrik
die mandarinenschalen duften
bis in den märz wenn rostdelta
tief in die fahrradlenker schaben
an den konturen brechen
die eisigen klingeln
eine bauplane spannt sich schlaff
um die narbige fassade
die blumentöpfe
wanken bis zum späten
gewitter forsch reißt das mauerwerk
auf frösteln die tauben in ihren nestern unter
schienenächzen